Selbst die besten Bands haben ein paar Leichen im Keller, bzw. im Backkatalog, und leider entdeckt man diese manchmal als erstes. Das passierte einem noch viel öfter, als man Musik noch nicht bequem im Internet streamen konnte und das heutzutage unvorstellbare Risiko eingehen musste, sich ein Album tatsächlich zu kaufen. Die Kaufentscheidung wurde dabei nicht selten von der Covergestaltung, irgendwelchen Dingen, die die jungen und noch leicht beeinflussbaren Ohren aufgeschnappt hatten, oder von der Empfehlung des pickligen Angestellten in der Musikabteilung des Elektromarktes beeinflusst.Und das ging natürlich nicht immer gut. Vielleicht wolltest du das erste Mal von Metallica kosten, hingst wegen St. Anger am Ende aber die ganze Nacht über der Kloschüssel. Das ist wirklich nicht dein Fehler! Wie hättest du auch wissen sollen, dass Sandinista! lediglich The Clash’s schamloser Versuch war, aus ihrem Plattenvertrag zu kommen, und alles andere als einen guten Einstieg in das Schaffen der einflussreichen Punkband darstellte? Es ist wirklich nichts, wofür man sich schämen muss, denn manchmal führten einen diese wenig ruhmreichen Werke auch zu den wahren Klassikern einer Band. In manchen Fällen eröffneten sie einem sogar ganz neue musikalische Welten, die einem bis dahin noch komplett verschlossen waren.Es ist schon eine sonderbare Verbindung, die du mit deinem Einstiegsalbum zu einer Band eingehst—ganz egal, ob es jetzt das „richtige“ Album ist oder nicht. Irgendetwas von der ersten Liebe bleibt immer hängen, egal wie peinlich das rückblickend auch sein mag. Hier sind ein paar Alben, durch die unsere Kollegen von Noisey US zum ersten Mal mit einer Band in Berührung gekommen sind. Weezer – The Green AlbumIch wünschte, ich könnte von mir behaupten, dass das Album, das für mein musikalisches Erwachen verantwortlich war, eines dieser gemeinhin anerkannten und respektierten Initiationsalben wie Dookie von Green Day oder London Calling von The Clash war. Aber in der Realität sah es leider so aus, dass ich ein schüchternes, komisches Einzelkind war, dessen Vater seit 1974 nichts mehr gehört hatte, was nicht Bruce Springsteen war, und dessen strenge, osteuropäische Mutter für derartige Frivolitäten wie Musik eh keine Zeit hatte. Napster steckte noch in den Kinderschuhen und so war mein musikalischer Werdegang ein unbeholfener, autodidaktischer Prozess. Mit 13 konnte meine CD-Sammlung schon mit Klassikern wie Third Eye Blinds Debüt-Album und N*SYNCs No Strings Attached aufwarten und da ich durch das Ausführen der Nachbarshunde einiges an Kleingeld angehäuft hatte, begab ich mich eines schönen Nachmittags zu Wherehouse Music, um Writing on the Wall von Destiny’s Child zu meiner Sammlung hinzufügen. Stattdessen stand ich aber plötzlich vor diesem knallgrünen Poster. Weezer. Ich hatte das Video für „Hash Pipe“ bei MTV gesehen, aber sonst wusste ich überhaupt nichts über die Band. Das Album kam zu meinem Einkauf hinzu und von da an sollte nichts mehr so sein früher. Wenn Beyoncé und Co meine Sehnsucht nach tanzbarem Pop und Freundschaften festigenden Übernachtungspartys befriedigten, dann sprachen Weezer die in mir aufkeimende Außenseiterin an, die immer seltener zu besagten Übernachtungspartys eingeladen wurde. Da mir jeglicher Referenzrahmen für Musik fehlte, die auch nur ansatzweise vom Mainstream abwich, wurde das von Ric Ocasek produzierte grüne Album meine Einstiegsdroge in die Welt des Rock’n’Roll: verzerrt, eingängig und treibend, aber auch angenehm unkompliziert. Ich war sofort bis über beide Ohren verliebt. Und lassen wir mal Rivers’ langweilige und manchmal absolut sinnfreien Refrains beiseite: In dem Alter konnte ich mit bedeutungsvollen Lyrics eh nicht viel anfangen. Es waren die Emotionen der Melodien, die mich wirklich bewegten. Ich ging von da schon bald zu Weezers früheren, komplexeren (und gemeinhin akzeptierteren) Alben wie dem Blue Album und Pinkerton über, die mich noch mehr begeisterten. Die wiederum brachten mich dann zu den Pixies, über die ich dann beim Punk landete, der mich wiederum zum Blues führte und so weiter. Meine Plattensammlung und ich lebten glücklich bis ans Ende unserer Tage.
Weezer – The Green AlbumIch wünschte, ich könnte von mir behaupten, dass das Album, das für mein musikalisches Erwachen verantwortlich war, eines dieser gemeinhin anerkannten und respektierten Initiationsalben wie Dookie von Green Day oder London Calling von The Clash war. Aber in der Realität sah es leider so aus, dass ich ein schüchternes, komisches Einzelkind war, dessen Vater seit 1974 nichts mehr gehört hatte, was nicht Bruce Springsteen war, und dessen strenge, osteuropäische Mutter für derartige Frivolitäten wie Musik eh keine Zeit hatte. Napster steckte noch in den Kinderschuhen und so war mein musikalischer Werdegang ein unbeholfener, autodidaktischer Prozess. Mit 13 konnte meine CD-Sammlung schon mit Klassikern wie Third Eye Blinds Debüt-Album und N*SYNCs No Strings Attached aufwarten und da ich durch das Ausführen der Nachbarshunde einiges an Kleingeld angehäuft hatte, begab ich mich eines schönen Nachmittags zu Wherehouse Music, um Writing on the Wall von Destiny’s Child zu meiner Sammlung hinzufügen. Stattdessen stand ich aber plötzlich vor diesem knallgrünen Poster. Weezer. Ich hatte das Video für „Hash Pipe“ bei MTV gesehen, aber sonst wusste ich überhaupt nichts über die Band. Das Album kam zu meinem Einkauf hinzu und von da an sollte nichts mehr so sein früher. Wenn Beyoncé und Co meine Sehnsucht nach tanzbarem Pop und Freundschaften festigenden Übernachtungspartys befriedigten, dann sprachen Weezer die in mir aufkeimende Außenseiterin an, die immer seltener zu besagten Übernachtungspartys eingeladen wurde. Da mir jeglicher Referenzrahmen für Musik fehlte, die auch nur ansatzweise vom Mainstream abwich, wurde das von Ric Ocasek produzierte grüne Album meine Einstiegsdroge in die Welt des Rock’n’Roll: verzerrt, eingängig und treibend, aber auch angenehm unkompliziert. Ich war sofort bis über beide Ohren verliebt. Und lassen wir mal Rivers’ langweilige und manchmal absolut sinnfreien Refrains beiseite: In dem Alter konnte ich mit bedeutungsvollen Lyrics eh nicht viel anfangen. Es waren die Emotionen der Melodien, die mich wirklich bewegten. Ich ging von da schon bald zu Weezers früheren, komplexeren (und gemeinhin akzeptierteren) Alben wie dem Blue Album und Pinkerton über, die mich noch mehr begeisterten. Die wiederum brachten mich dann zu den Pixies, über die ich dann beim Punk landete, der mich wiederum zum Blues führte und so weiter. Meine Plattensammlung und ich lebten glücklich bis ans Ende unserer Tage.
—Andrea DomanickThe Misfits – American PsychoWie die meisten 13-Jährigen, die in der Schule unbeliebt genug sind, um ihre Teenagerjahre von Punkrock bestimmen zu lassen, kaufte ich mir CDs von Bands, die mir als offiziell anerkannte Punkbands bekannt waren: Dead Kennedys, Minor Threat, The Misfits. Minor Threat waren einfach—es gab ja nur ein einziges Album. Bei DK hatte ich mit Fresh Fruit einen Glücksgriff gelandet, aber von den Misfits kaufte ich ihr damals aktuellstes Album, American Psycho. Ich „verstand" es. Irgendwie. Das Booklet ließ sich zu einem Poster aufklappen, das ich mir an die Wand hing. Das Album war, puh … also, es war ziemlich cool. Fand ich. Diese legendäre Band, die jeder Punk, der seiner Nietengürtel wert sein wollte, mögen muss, fand ich toooootal gut. Echt jetzt. Ich gehörte zu den coolen Punks. Irgendwo in mir merkte ich jedoch, dass das Album irgendwie Mist war—allein dieser aufpolierte Metallica Sound—aber hey, das hier waren die Misfits! Die unzähligen Backpatches cooler Iro-Punker konnten doch nicht lügen. Aber ich lag falsch. Natürlich. American Psycho war JAHRE nach dem entstanden, was jeder Misfitis-Fan, der morgens noch in den Spiegel gucken kann, zum Kanon der Band zählen würde. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich damals an 50 US-Dollar gekommen war, aber ich ging los und kaufte mir das Box-Set. Plötzlich machte alles Klick! Earth A.D., Static Age, Evilive. Danzig, verdammt noch mal! Das waren die echten Misfits. Danach vergrub ich American Psycho ganz tief in meinem Unterbewusstsein und schaute nie wieder zurück. Und auch heute werde ich kein gutes Haar an American Psycho lassen, auch wenn ich peinlicherweise mehr Lyrics von der Platte auswendig kann, als ich jemals bereit wäre, zuzugeben.
—Dan OzziThe Stone Roses – The Second Coming1994 drehte sich alles um den Wu-Tang Clan, Snapcase, Fugazi und alles andere, was irgendwie Punk oder dreckig war. Ich war durch meine Phase klassischen Alternativerocks gegangen und liebte immer noch Bands wie The Cure, New Order und andere, aber das, was abseits von dem lag, was Dave Kendall mir bei MTVs Serien120 Minutes oder WHFS als cool verkaufte, musste ich erst noch entdecken. Trotz all des Lärms hatte ich auch ein paar Dinge über die Stone Roses gehört—wie großartig sie doch seien und dass ich sie mir unbedingt anhören müsse.Als The Second Coming fünf Jahre nach dem selbstbetitelten Album um die Ecke kam, wurde die Platte ziemlich gepusht, wozu auch eine starke Single in Form des Silde-Gitarren-Burners „Love Spreads“ gehörte. Es wurde im Radio gespielt, dann kam das Video und dann endlich „verstand ich sie“ (das dachte ich jedenfalls) und bin kurz darauf zu Tower Records. Was für ein Fehlkauf. Natürlich sah ein Kumpel ein paar Monate später meine Kopie von The Second Coming und kommentierte das mit, „Du hast dir die gekauft? Du solltest dir mal das erste Album anhören, dann verstehst du, wie die wirklich sind!“ Und in der Tat, das war es definitiv. Die Platte bekam dann auch in einer der besten Szenen von Shaun of the Dead ihr Fett weg.—Fred Pessaro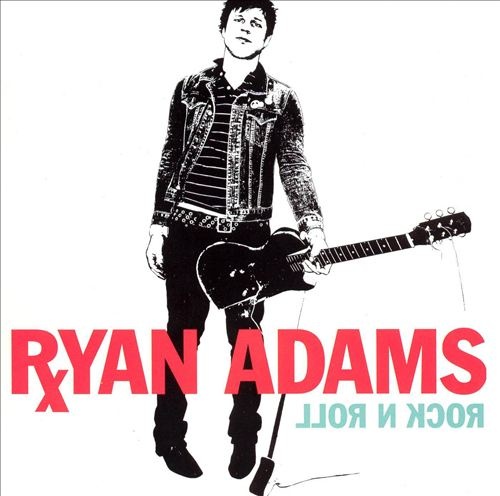 Ryan Adams – Rock n RollMeine ersten paar Monate, nachdem ich vom College wieder zuhause gelandet war, waren ziemlich ätzend. Der Post-9/11-Arbeitsmarkt in meiner Stadt war furchtbar und ich war ein überarbeiteter und unterbezahlter Packesel im Einzelhandel, der sich kein soziales Leben abseits der Komfortzone von immateriellen Videospielcharakteren leisten konnte. Ich war traurig und dramatisch, also mochte ich auch meine Musik traurig und dramatisch. Aus Nostalgiegründen fing ich an, noch einmal durch die ganze wunderbar traurige Bastardmusik zu wühlen, auf die mich meine Collegefreunde in den vier Jahren davor gebracht hatten, die ich als überzeugter Indie-Bro mich aber geweigert hatte zu hören. Das hieß im Endeffekt ein ganzer Haufen Wilco und Ryan Adams. 2003 versucht sich Adams dann mit seinem abgedroschen betitelten Album Rock n Roll an fröhlichem, ironischen Glam Rock und ich kaufte es mir—aus welchem Grund auch immer. Mir gefiel das vermeintlich-fröhliche-aber-eigentlich-total-traurige „So Alive“, das sich im Rückblick anhört, als würde sich Rufus Wainwright an einer Karaoke-Version von U2 versuchen—eine durch und durch beschissene Idee halt. Wahrlich düstere Zeiten. Zum Glück wurde ich in den nachfolgenden Jahren wesentlich schlauer darin, meine deprimierende Musik auszusuchen (Pornography, Baby!) und Ryan sollte sich etwas zurücknehmen und die Stimmungsexperimente runterschrauben. Nun, größtenteils jedenfalls.
Ryan Adams – Rock n RollMeine ersten paar Monate, nachdem ich vom College wieder zuhause gelandet war, waren ziemlich ätzend. Der Post-9/11-Arbeitsmarkt in meiner Stadt war furchtbar und ich war ein überarbeiteter und unterbezahlter Packesel im Einzelhandel, der sich kein soziales Leben abseits der Komfortzone von immateriellen Videospielcharakteren leisten konnte. Ich war traurig und dramatisch, also mochte ich auch meine Musik traurig und dramatisch. Aus Nostalgiegründen fing ich an, noch einmal durch die ganze wunderbar traurige Bastardmusik zu wühlen, auf die mich meine Collegefreunde in den vier Jahren davor gebracht hatten, die ich als überzeugter Indie-Bro mich aber geweigert hatte zu hören. Das hieß im Endeffekt ein ganzer Haufen Wilco und Ryan Adams. 2003 versucht sich Adams dann mit seinem abgedroschen betitelten Album Rock n Roll an fröhlichem, ironischen Glam Rock und ich kaufte es mir—aus welchem Grund auch immer. Mir gefiel das vermeintlich-fröhliche-aber-eigentlich-total-traurige „So Alive“, das sich im Rückblick anhört, als würde sich Rufus Wainwright an einer Karaoke-Version von U2 versuchen—eine durch und durch beschissene Idee halt. Wahrlich düstere Zeiten. Zum Glück wurde ich in den nachfolgenden Jahren wesentlich schlauer darin, meine deprimierende Musik auszusuchen (Pornography, Baby!) und Ryan sollte sich etwas zurücknehmen und die Stimmungsexperimente runterschrauben. Nun, größtenteils jedenfalls.
—Craig JenkinsSlipknot – Iowa2001 war ich 14 und sehr, sehr wütend. Ich kann rückblickend nicht mehr wirklich erklären, warum ich so wütend war, dass ich gegen Wände geboxt und Menschen in Schließfächer geschubst habe und dazu verdonnert wurde, an einem Anti-Aggressionstraining teilzunehmen, aber es war wahrscheinlich nur ein bunter Strauß aus typischen Teenagerproblemen, die durch vererbte aggressive Tendenzen gefiltert wurden (Danke, Papa!). Was auch immer es war, es verlangte nach einem passenden Soundtrack, und dank ein paar älterer, von Hot Topic-besessener Freunde entdeckte ich die perfekte akustische Begleitung zu meiner beschissenen, selbstgerechten Teenager-Einstellung: Slipknot. Mir hatte es vor allem ihr zweites Album, Iowa, mit dem glänzenden, silbrig-blauen Cover und fantastischen Tracktiteln wie „People = Shit“ und „The Heretic Anthem“ angetan. Mittlerweile klingt das alles zwar ausgelutscht und abgedroschen, weil ich die 13 darauffolgenden Jahre mit dem Hören von rumpeligem War Metal verbrachte, aber damals war es einfach das Extremste, was ich je gehört hatte—der direkte Vorbote für mein aufkeimendes Interesse an Death Metal, wodurch ich bei Grind landete, der mich wiederum zu Black Metal, Doom und letztendlich Crust Punk führte. Ich kann mich glücklich schätzen, dass meine Nu-Metal-Phase vermeintlich kurz war, aber ich kann nicht verleugnen, dass sie mir den Weg in Richtung des Pfades der linken Hand leuchtete.
—Kim Kelly Bob Dylan – Self PortraitBob Dylans Self Portrait, das 1970 zwischen Klassikern wie Nashville Skyline und New Morning erschien, war bei den Kritikern nicht gerade beliebt. Ernsthaft, man kann es auch direkter ausdrücken: Absolut jeder fand es beschissen! Man war sich auch allgemein einig darüber, dass etwas dahinter stecken musste—das Konzept der Selbstbetrachtung (oder sowas) und was dieser Ausdruck bedeutet und wie wir als menschliche Wesen damit umgehen—und dass diese Idee es wert war, untersucht und erkundet zu werden (man hatte es hier immerhin noch mit einem Bob-Dylan-Album zu tun). Gleichzeitig wurde aber wirklich überall schlecht über das Album geredet. Einige Musikjournalisten (ziemlich sicher weiße Männer) bezeichneten das Album in Kombination mit der Trennung der Beatles als das wahre Ende der 60er Jahre. Die legendäre Rezension von Greil Marcus im Rolling Stone beginnt tatsächlich mit dem einfachen Satz: „What is this shit?“ Nein, das war keine gute Zeit für Bob Dylan.Die negative Resonanz ist wahrscheinlich gerechtfertigt, wenn die größte Sorge bei Musik für einen ist, die richtige Meinung zu haben. Und ich will auch gar nicht anfangen, den Wert von Self Portrait mit der anderen fantastischen Musik zu vergleichen, die Bob Dylan im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Außerdem war ich minus 17 Jahre alt, als das Album veröffentlicht wurde. In meiner rückblickenden Meinung als Experte fühlt es sich ein bisschen so an, als hätten die Kritiker überreagiert, weil Dylan ihnen nicht das Album gab, das sie wollten. Self Portrait ist verspielt, wirr und unvollständig. Es hat keine einzige polierte Kante—seine furchtbaren Vocals (und das war zu einer Zeit, als er noch wirklich singen konnte) sind langgezogen und keuchend, seine Gitarrenriffs schlampig, sein Songwriting unkonzentriert. Genau das war es aber, was mir an der Platte so viel Spaß gemacht hat, als ich sie als Kind zum ersten Mal gehört hatte. Ich hatte natürlich auch vorher schon Bob Dylan gehört—es ist quasi unmöglich, im Mittleren Westen auf die Welt zu kommen und nicht mit „Ramblin’ Man“ zwangsernährt zu werden—aber das hier war das erste Album, das mir eine andere Seite von Dylan zeigte, eine, die mehr auf Selbstfindung und dem Verstehen seines eigenen Platzes in der Welt fußt. Es brachte mir bei, dass es vollkommen OK ist, nicht perfekt zu sein. Niemand ist perfekt. Musik, die perfekt ist, ist langweilig. Self Portrait versuchte gar nicht erst, perfekt zu sein—es versuchte einfach, menschlich zu sein. Es macht gar nicht mal so großen Spaß, sich unsere eignen Fehler anzuschauen, nicht wahr?—Eric SundermannNine Inch Nails – With TeethDamals, in der sechsten Klasse, dachte ich aus irgendeinem Grund, dass es total cool sein würde, Goth zu sein. Marilyn Manson, Jeff Hardy, sich irgendwelche Bücher über Geisterbeschwörungen kaufen—alles super! Es war also ganz normal, dass ich durch das 2005 erschienene Album With Teeth auch bei den Nine Inch Nails landete. Ich hatte sie vorher nie so richtig verstanden, aber ich wusste, dass das hier das erste Nine Inch Nails-Album seit 1999 war. Rückblickend, und auch um einen erstklassigen Witz zu machen, muss ich sagen, dass das Album komplett zahnlos war. Jedes Album davor verfügte über die ganzen Faktoren, die die Nine Inch Nails zu einer großartigen Band und Trent Reznor zu einem großartigen Musiker machten. Es gab dort eine Furchtlosigkeit hinter der Art von Elektronika und der Hardware. With Teeth lässt in einem hingegen das Gefühl aufkeimen, dass es von einer Alt-Rock-Band aus einer schlechten Folge Law & Order: SVU stammen könnte. Die Songs waren scheiße langweilig, nicht wirklich durchdacht und so einfach, dass es wehtat. Es klang alles so, als würde Trent herausfinden wollen, wie gut er Popsongs schreiben kann oder ob er ein zweites „Hurt“ hinbekommt. Zumindest die Live-DVD war ganz cool, schätze ich.
Bob Dylan – Self PortraitBob Dylans Self Portrait, das 1970 zwischen Klassikern wie Nashville Skyline und New Morning erschien, war bei den Kritikern nicht gerade beliebt. Ernsthaft, man kann es auch direkter ausdrücken: Absolut jeder fand es beschissen! Man war sich auch allgemein einig darüber, dass etwas dahinter stecken musste—das Konzept der Selbstbetrachtung (oder sowas) und was dieser Ausdruck bedeutet und wie wir als menschliche Wesen damit umgehen—und dass diese Idee es wert war, untersucht und erkundet zu werden (man hatte es hier immerhin noch mit einem Bob-Dylan-Album zu tun). Gleichzeitig wurde aber wirklich überall schlecht über das Album geredet. Einige Musikjournalisten (ziemlich sicher weiße Männer) bezeichneten das Album in Kombination mit der Trennung der Beatles als das wahre Ende der 60er Jahre. Die legendäre Rezension von Greil Marcus im Rolling Stone beginnt tatsächlich mit dem einfachen Satz: „What is this shit?“ Nein, das war keine gute Zeit für Bob Dylan.Die negative Resonanz ist wahrscheinlich gerechtfertigt, wenn die größte Sorge bei Musik für einen ist, die richtige Meinung zu haben. Und ich will auch gar nicht anfangen, den Wert von Self Portrait mit der anderen fantastischen Musik zu vergleichen, die Bob Dylan im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Außerdem war ich minus 17 Jahre alt, als das Album veröffentlicht wurde. In meiner rückblickenden Meinung als Experte fühlt es sich ein bisschen so an, als hätten die Kritiker überreagiert, weil Dylan ihnen nicht das Album gab, das sie wollten. Self Portrait ist verspielt, wirr und unvollständig. Es hat keine einzige polierte Kante—seine furchtbaren Vocals (und das war zu einer Zeit, als er noch wirklich singen konnte) sind langgezogen und keuchend, seine Gitarrenriffs schlampig, sein Songwriting unkonzentriert. Genau das war es aber, was mir an der Platte so viel Spaß gemacht hat, als ich sie als Kind zum ersten Mal gehört hatte. Ich hatte natürlich auch vorher schon Bob Dylan gehört—es ist quasi unmöglich, im Mittleren Westen auf die Welt zu kommen und nicht mit „Ramblin’ Man“ zwangsernährt zu werden—aber das hier war das erste Album, das mir eine andere Seite von Dylan zeigte, eine, die mehr auf Selbstfindung und dem Verstehen seines eigenen Platzes in der Welt fußt. Es brachte mir bei, dass es vollkommen OK ist, nicht perfekt zu sein. Niemand ist perfekt. Musik, die perfekt ist, ist langweilig. Self Portrait versuchte gar nicht erst, perfekt zu sein—es versuchte einfach, menschlich zu sein. Es macht gar nicht mal so großen Spaß, sich unsere eignen Fehler anzuschauen, nicht wahr?—Eric SundermannNine Inch Nails – With TeethDamals, in der sechsten Klasse, dachte ich aus irgendeinem Grund, dass es total cool sein würde, Goth zu sein. Marilyn Manson, Jeff Hardy, sich irgendwelche Bücher über Geisterbeschwörungen kaufen—alles super! Es war also ganz normal, dass ich durch das 2005 erschienene Album With Teeth auch bei den Nine Inch Nails landete. Ich hatte sie vorher nie so richtig verstanden, aber ich wusste, dass das hier das erste Nine Inch Nails-Album seit 1999 war. Rückblickend, und auch um einen erstklassigen Witz zu machen, muss ich sagen, dass das Album komplett zahnlos war. Jedes Album davor verfügte über die ganzen Faktoren, die die Nine Inch Nails zu einer großartigen Band und Trent Reznor zu einem großartigen Musiker machten. Es gab dort eine Furchtlosigkeit hinter der Art von Elektronika und der Hardware. With Teeth lässt in einem hingegen das Gefühl aufkeimen, dass es von einer Alt-Rock-Band aus einer schlechten Folge Law & Order: SVU stammen könnte. Die Songs waren scheiße langweilig, nicht wirklich durchdacht und so einfach, dass es wehtat. Es klang alles so, als würde Trent herausfinden wollen, wie gut er Popsongs schreiben kann oder ob er ein zweites „Hurt“ hinbekommt. Zumindest die Live-DVD war ganz cool, schätze ich.
—John HillGreen Day – American IdiotBevor ich hier loslege, sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich mit 13 in einem sehr abgelegenem Kaff lebte. Klar, ich hatte Internet, aber ich wusste nicht unbedingt, wie man es sinnvoll benutzt. Ich kannte Green Day nur von dem Dookie-Shirt, zu dem mein coolerer, älterer Cousin seine Mutter irgendwie überreden konnte—und trotzdem war ich nicht schlau genug, um mich über sie zu informieren. Ich weiß noch nicht mal, wie ich auf sie gekommen war oder was mich dazu brachte, mir gerade dieses Album anzuschauen. Wie ich eben schon sagte, ich war nicht gerade schlau. Jedenfalls war das verhängnisvolle American Idiot das erste Album, das ich von Green Day in die Finger bekam. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass ich das Album wirklich mochte—ich muss es mir bestimmt 100 Mal angehört haben. Der Chorus im Übergang von „Are We the Waiting/St. Jimmy“, der plötzlich von schnellen und heftigen Akkorden unterbrochen wurde, klang einfach gut. Und natürlich sprach mich als deprimierte Teenagerin, die ich damals war, „Wake Me Up When September Ends“ total an. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem sich der coole Junge im Schulbus, in den ich heimlich verknallt war, zu mir umdrehte, während ich die CD in meinen Sony Walkman packte oder wie das hieß (ja, ich war zu arm für einen iPod, falls ihr euch fragt), und mich fragte, welche CD ich mir anhörte. „Die neue Green Day“, antwortete ich stolz, worauf er mir sofort antwortete, dass sie scheiße sei und die Band seit Nimrod kein gutes Album mehr gemacht habe. Ich erzählte dann sofort, dass die CD einer Freundin gehöre und ich sie mir gerade zum ersten Mal anhören würde. Als ich dann zuhause ankam, überredete ich meine Mutter sofort, mich zu Wal-Mart zu fahren und, nur Gott weiß warum, dort hatten sie sogar Nimrod im Regal.
—Annalise Domenighini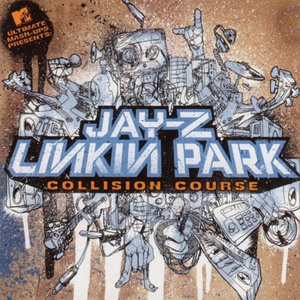 Jay-Z / Linkin Park – Collision CourseMit 14 ist eigentlich niemand besonders schlau. Ich war zum Beispiel großer Linkin Park-Fan. Ihre Mischung aus Rapgesang und Gitarren, kombiniert mit Anime-Ästhetik entsprach perfekt meiner Vorstellung davon, wie einzigartig ich doch war, und so hörte ich ihre Alben während meiner nächtlichen Neopets-Marathons rauf und runter. Eines Tages, nachdem ich mir über Bearshare einen Haufen neuer Songs heruntergeladen hatte, stolperte ich über einen Linkin Park-Song, in dem der Rap nicht nur passabel, sondern richtig gut war. Ich schaute mir die Credits an und war überrascht, dort einen Namen zu lesen, den ich bis dahin nie gehört hatte: Jay-Z. Ich hatte mir Collision Course runtergeladen und war so ganz nebenbei mit dem besten Rapper aller Zeiten in Kontakt gekommen. Und das sollte erst der Anfang sein. Ich arbeitete mich schnell durch das Album und kam zu dem Schluss, dass mir Jay-Zs flüssige Delivery besser als Chesters Stakkato gefiel. Als ich genug von Collision Course hatte, besorgte ich mir The Black Album. Linkin Park erlaubten es mir, so zu tun, als wären die Leute in meinen Kopfhörern genau wie ich, aber Jay-Z eröffnete mir eine ganz neue Welt, die sich um seinen eigenen Mythos drehte und die mich irgendwann dazu brachte, alles über ihren zentralen Charakter zu wissen. Letztendlich ließ ich meine Liebe zu Linkin Park hinter mir, tauchte tief in die Geschichte von Jay-Z ein und folgte jedem seiner Kollaborationszweige in die unterschiedlichsten Richtungen, bis die Storys, die ich hörte, über die Marcy Projects hinausgingen und sich in jede größere Ecke Amerikas ausweiteten. Also danke, Linkin Park, dafür, dass ihr die Einstiegsdroge wart, die es mir erlaubt habt, auf Jay-Z zu kommen. Endlich habt ihr mal etwas richtig gemacht.
Jay-Z / Linkin Park – Collision CourseMit 14 ist eigentlich niemand besonders schlau. Ich war zum Beispiel großer Linkin Park-Fan. Ihre Mischung aus Rapgesang und Gitarren, kombiniert mit Anime-Ästhetik entsprach perfekt meiner Vorstellung davon, wie einzigartig ich doch war, und so hörte ich ihre Alben während meiner nächtlichen Neopets-Marathons rauf und runter. Eines Tages, nachdem ich mir über Bearshare einen Haufen neuer Songs heruntergeladen hatte, stolperte ich über einen Linkin Park-Song, in dem der Rap nicht nur passabel, sondern richtig gut war. Ich schaute mir die Credits an und war überrascht, dort einen Namen zu lesen, den ich bis dahin nie gehört hatte: Jay-Z. Ich hatte mir Collision Course runtergeladen und war so ganz nebenbei mit dem besten Rapper aller Zeiten in Kontakt gekommen. Und das sollte erst der Anfang sein. Ich arbeitete mich schnell durch das Album und kam zu dem Schluss, dass mir Jay-Zs flüssige Delivery besser als Chesters Stakkato gefiel. Als ich genug von Collision Course hatte, besorgte ich mir The Black Album. Linkin Park erlaubten es mir, so zu tun, als wären die Leute in meinen Kopfhörern genau wie ich, aber Jay-Z eröffnete mir eine ganz neue Welt, die sich um seinen eigenen Mythos drehte und die mich irgendwann dazu brachte, alles über ihren zentralen Charakter zu wissen. Letztendlich ließ ich meine Liebe zu Linkin Park hinter mir, tauchte tief in die Geschichte von Jay-Z ein und folgte jedem seiner Kollaborationszweige in die unterschiedlichsten Richtungen, bis die Storys, die ich hörte, über die Marcy Projects hinausgingen und sich in jede größere Ecke Amerikas ausweiteten. Also danke, Linkin Park, dafür, dass ihr die Einstiegsdroge wart, die es mir erlaubt habt, auf Jay-Z zu kommen. Endlich habt ihr mal etwas richtig gemacht.
—Slava Pastuk Guns N' Roses – Use Your Illusion I & IIAls Guns N’ Roses im September 1991 ihr ambitioniertes Doppelalbum veröffentlichten, drückte ich noch fleißig den Repeat-Knopf bei „I Love Your Smile“ von Shanice und „Around the Way Girl“ von LL Cool J. Ich hatte gerade San Francisco verlassen und war nach Holland gezogen und ich vermisste meine tägliche Dosis KMEL, dem R’n’B/HipHop-Radiosender Nummer Eins in der Bay Area. Damals hielt ich Bon Jovi noch für Heavy Metal.Ein Jahr später zogen meine Mutter, mein Stiefvater und ich nach Southampton, England, und ich freundete mich dort in der Schule mit einer Gruppe von Kindern an, die abfällig als „die Hippies“ bezeichnet wurden. Wir trugen Docs und Flanellhemden. Die Mädchen hatten einen Faible für Batik und die Jungs eine Aversion gegen Shampoo, weil es ihre Cobain-gleiche Frisur zu fluffig werden ließ. Ich vergaß Boys II Men ganz schnell und hörte Nirvana, natürlich, aber auch Ugly Kid Joe, Metallica und Blind Melon. Und auch wenn Guns N’ Roses für alles standen, was Nirvana verachteten und ablehnten, hörten wir die beiden Use Your Illusion-Platten rauf und runter—zwei aufgeblasene Alben, die am gleichen Tag veröffentlicht worden waren und die, als wir sie hörten, schon ein Jahr alt waren.Rückblickend war das Album der 151 Minuten dauernde Grabgesang von Axl und seiner herausgeputzten Crew von besoffenen Rock-Eidechsen. Die Exzesse des letzten Jahrzehnts hatten jede künstlerische Entscheidung auf diesem Album geprägt: die ausufernde Länge der Songs; die Millionen US-Dollar, die für bombastische Videos ausgegeben wurden; dieses Verlangen nach der absoluten Weltherrschaft, das sich in Rockballaden und radiofreundlichen Hooks wiederfand. Ein Zehn-Minuten-Song ohne einen einzigen Refrain! Nein, sie waren wohl kaum eine Gruppe von Rebellen, sondern dank Säcken voller Koks und Jacuzzis voller Jack Daniels—und ja, auch Heroin—muss sich einfach jede ihrer Ideen genial angefühlt haben. Hier wurde nichts verworfen! Und trotzdem liebte ich damals die überladenen Soli von Slash (und diese unter dem Lockenwirrwar hervorschauende Schnute) und machte energische Faustbewegungen zu Axls schrillem Gejaule. Heutzutage kann ich angesichts dieser Selbstgefälligkeit, 30 Tracks an einem Tag zu veröffentlichen, nur die Nase rümpfen, aber damals war das eine wahre Goldgrube. Von „November Rain“, „Civil War“, den bombastischen Riffs von „You Could Be Mine“ und ein paar anderen mal abgesehen, waren diese beiden Alben gepflastert mit abschweifendem Füllmaterial, das zu einem kompakten Album zusammengekürzt hätte werden können und sollen. Da ich 1987 aber noch Salt-N-Pepa und Madonna hörte, war UYI mein erster Kontakt mit GN’R und von dort stürzte ich mich Hals über Kopf in Appetite for Destruction—ein Debüt, das wie eine tollwütiger Hund in der Hitze schäumt. Es ist eine der großartigsten Rockplatten der 80er Jahre—und eine, die Guns N’ Roses nie besser hinbekommen haben.
Guns N' Roses – Use Your Illusion I & IIAls Guns N’ Roses im September 1991 ihr ambitioniertes Doppelalbum veröffentlichten, drückte ich noch fleißig den Repeat-Knopf bei „I Love Your Smile“ von Shanice und „Around the Way Girl“ von LL Cool J. Ich hatte gerade San Francisco verlassen und war nach Holland gezogen und ich vermisste meine tägliche Dosis KMEL, dem R’n’B/HipHop-Radiosender Nummer Eins in der Bay Area. Damals hielt ich Bon Jovi noch für Heavy Metal.Ein Jahr später zogen meine Mutter, mein Stiefvater und ich nach Southampton, England, und ich freundete mich dort in der Schule mit einer Gruppe von Kindern an, die abfällig als „die Hippies“ bezeichnet wurden. Wir trugen Docs und Flanellhemden. Die Mädchen hatten einen Faible für Batik und die Jungs eine Aversion gegen Shampoo, weil es ihre Cobain-gleiche Frisur zu fluffig werden ließ. Ich vergaß Boys II Men ganz schnell und hörte Nirvana, natürlich, aber auch Ugly Kid Joe, Metallica und Blind Melon. Und auch wenn Guns N’ Roses für alles standen, was Nirvana verachteten und ablehnten, hörten wir die beiden Use Your Illusion-Platten rauf und runter—zwei aufgeblasene Alben, die am gleichen Tag veröffentlicht worden waren und die, als wir sie hörten, schon ein Jahr alt waren.Rückblickend war das Album der 151 Minuten dauernde Grabgesang von Axl und seiner herausgeputzten Crew von besoffenen Rock-Eidechsen. Die Exzesse des letzten Jahrzehnts hatten jede künstlerische Entscheidung auf diesem Album geprägt: die ausufernde Länge der Songs; die Millionen US-Dollar, die für bombastische Videos ausgegeben wurden; dieses Verlangen nach der absoluten Weltherrschaft, das sich in Rockballaden und radiofreundlichen Hooks wiederfand. Ein Zehn-Minuten-Song ohne einen einzigen Refrain! Nein, sie waren wohl kaum eine Gruppe von Rebellen, sondern dank Säcken voller Koks und Jacuzzis voller Jack Daniels—und ja, auch Heroin—muss sich einfach jede ihrer Ideen genial angefühlt haben. Hier wurde nichts verworfen! Und trotzdem liebte ich damals die überladenen Soli von Slash (und diese unter dem Lockenwirrwar hervorschauende Schnute) und machte energische Faustbewegungen zu Axls schrillem Gejaule. Heutzutage kann ich angesichts dieser Selbstgefälligkeit, 30 Tracks an einem Tag zu veröffentlichen, nur die Nase rümpfen, aber damals war das eine wahre Goldgrube. Von „November Rain“, „Civil War“, den bombastischen Riffs von „You Could Be Mine“ und ein paar anderen mal abgesehen, waren diese beiden Alben gepflastert mit abschweifendem Füllmaterial, das zu einem kompakten Album zusammengekürzt hätte werden können und sollen. Da ich 1987 aber noch Salt-N-Pepa und Madonna hörte, war UYI mein erster Kontakt mit GN’R und von dort stürzte ich mich Hals über Kopf in Appetite for Destruction—ein Debüt, das wie eine tollwütiger Hund in der Hitze schäumt. Es ist eine der großartigsten Rockplatten der 80er Jahre—und eine, die Guns N’ Roses nie besser hinbekommen haben.
—Kim Taylor Bennett**Folgt Noisey bei Facebook und Twitter.
Anzeige

—Andrea Domanick
Anzeige
—Dan Ozzi
Anzeige
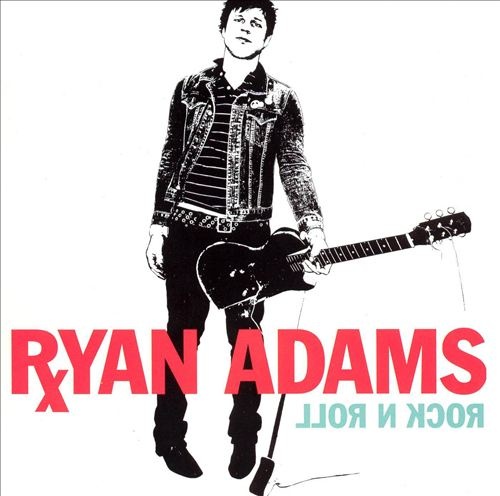
—Craig Jenkins
Anzeige
—Kim Kelly
Anzeige

Anzeige
—John HillGreen Day – American IdiotBevor ich hier loslege, sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich mit 13 in einem sehr abgelegenem Kaff lebte. Klar, ich hatte Internet, aber ich wusste nicht unbedingt, wie man es sinnvoll benutzt. Ich kannte Green Day nur von dem Dookie-Shirt, zu dem mein coolerer, älterer Cousin seine Mutter irgendwie überreden konnte—und trotzdem war ich nicht schlau genug, um mich über sie zu informieren. Ich weiß noch nicht mal, wie ich auf sie gekommen war oder was mich dazu brachte, mir gerade dieses Album anzuschauen. Wie ich eben schon sagte, ich war nicht gerade schlau. Jedenfalls war das verhängnisvolle American Idiot das erste Album, das ich von Green Day in die Finger bekam. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass ich das Album wirklich mochte—ich muss es mir bestimmt 100 Mal angehört haben. Der Chorus im Übergang von „Are We the Waiting/St. Jimmy“, der plötzlich von schnellen und heftigen Akkorden unterbrochen wurde, klang einfach gut. Und natürlich sprach mich als deprimierte Teenagerin, die ich damals war, „Wake Me Up When September Ends“ total an. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem sich der coole Junge im Schulbus, in den ich heimlich verknallt war, zu mir umdrehte, während ich die CD in meinen Sony Walkman packte oder wie das hieß (ja, ich war zu arm für einen iPod, falls ihr euch fragt), und mich fragte, welche CD ich mir anhörte. „Die neue Green Day“, antwortete ich stolz, worauf er mir sofort antwortete, dass sie scheiße sei und die Band seit Nimrod kein gutes Album mehr gemacht habe. Ich erzählte dann sofort, dass die CD einer Freundin gehöre und ich sie mir gerade zum ersten Mal anhören würde. Als ich dann zuhause ankam, überredete ich meine Mutter sofort, mich zu Wal-Mart zu fahren und, nur Gott weiß warum, dort hatten sie sogar Nimrod im Regal.
—Annalise Domenighini
Anzeige
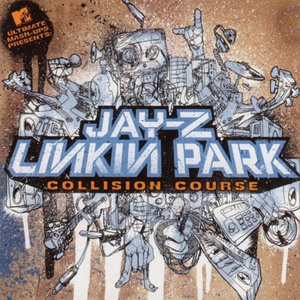
—Slava Pastuk
Anzeige

—Kim Taylor Bennett**Folgt Noisey bei Facebook und Twitter.
