Drake mit seinem VaterJa, die sozialen Netzwerke machen es einem unglaublich leicht, alles und jeden zu hassen. Auf Facebook fängst du schon an, Menschen zu hassen, nur weil sie vermeintlich erfolgreich sind, während du seit drei Tagen in der gleichen stinkenden Jogginghose vor dem Rechner sitzt. Es kann schwierig werden, einen weiteren selbstbeweihräuchernden Tweet einer Kollegin zu verdauen, wenn du gerade selber alle Mühen hast, mit einem ganzen Haufen Stress fertigzuwerden. Scheiß doch auf sie und alles, was sie pinteressiert.Wird geladen
Anzeige
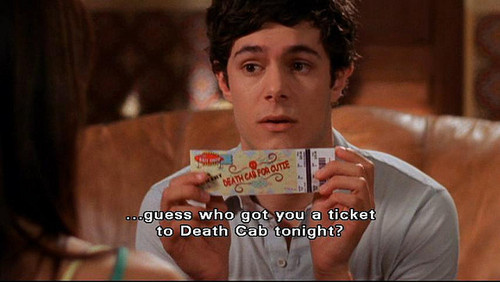
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
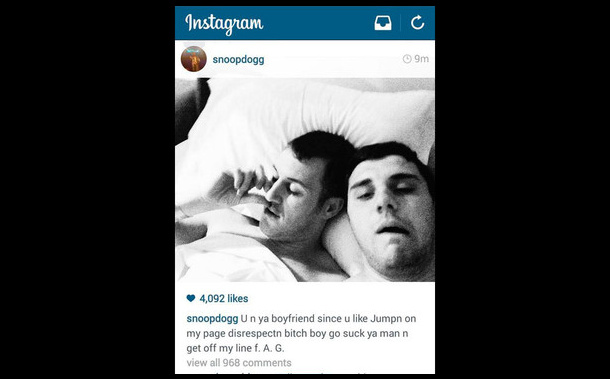
Anzeige
